Wenn man die interessanteste Meldung des neuen Jahres nicht verpassen wollte, dann musste man schon sehr genau hinschauen. Auf den großen Webseiten fand sie nämlich nicht statt. Und wenn sie in den sozialen Netzwerken überhaupt diskutiert wurde, dann hinter verschlossenen Türen. Dabei wirft sie ein bemerkenswertes Schlaglicht auf die kriselnde deutsche Spielebranche – und auf ihre Protagonisten, die zum Teil ums nackte Überleben kämpfen.
Es beginnt am 17. Januar mit einer vermeintlich harmlosen Pressemeldung des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU): Zum Jahresbeginn seien fünf neue Mitglieder in die hauseigenen Netzwerke BIU.Net und BIU.Dev eingetreten. Der größte deutsche Branchenverband begrüßt neben Riot Games, dem Berliner Dienstleister AdSpree, der Standortinitiative gamearea-FRM e.v. und der Event-Agentur Trusted Events auch die Game-Design-Sparte von Gauselmann.
Nun muss man wissen, dass es sich bei Gauselmann um den führenden deutschen Hersteller von Geldspielautomaten und Betreiber von Spielhallen (Merkur) handelt. Die Firma unterhält außerdem Online-Casinos, bietet Sportwetten an und produziert Geldwechsel- und Zahlungssysteme sowie Casino-Software. Man muss ebenfalls wissen, dass die jährlich 500 Euro teure Mitgliedschaft im BIU.Dev-Netzwerk keine vollwertige Verbandsmitgliedschaft mit Stimmrecht darstellt, sondern „lediglich“ den Zugang zu einer exklusiven Netzwerkplattform gewährt. Als Leistungen für BIU.Dev-Mitglieder nennt der Verband unter anderem eine Rechtsberatung, Kontaktvermittlung, professionelle Beratung zur Fördermittelakquise, regelmäßige Seminare und Workshops sowie Erstberatung zu Verbraucher- und Jugendschutz in Kooperation mit der USK.

Firmengründer Paul Gauselmann (Bild: obs/Gauselmann Gruppe/Marco Moog)
Von einer breiten Spiele-Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, sorgt die Meldung in Entwickler- und Industriekreisen für Aufsehen und hitzige Diskussionen. „Sehr befremdlich“, sagt mir zum Beispiel ein Mitarbeiter eines im BIU stimmberechtigten Herstellers. „Die gehören nicht dazu. Das ist Glücksspiel“, sagt ein anderer. Und ergänzt: „Das hat ein kräftiges Geschmäckle“. Von einer fatalen Signalwirkung ist die Rede. Politisch unklug sei das. Und ob da wohl Geld im Spiel gewesen sei. Thomas Dlugaiczyk, Gründer und Rektor der Games Academy, wirft dem BIU in einem Gastkommentar auf der Branchenwebseite Gameswirtschaft eine „imperiale Haltung“ vor. Es gibt aber auch Befürworter: Der BIU sei nun einmal kein Kultur-, sondern ein Wirtschaftsverband. Glücksspieleentwickler seien ebenso Spieleentwickler wie alle anderen auch. Social-Casino-Games seien bei einigen Free2Play-Anbietern ein großes Thema – warum solle sich Gauselmann von dieser Seite nicht annähern?
Vergangene Woche macht der BIU plötzlich auf dem Absatz kehrt. „Die Game-Design-Sparte von Gauselmann ist kein Mitglied von BIU.Dev mehr“, heißt es in einer Aktualisierung der ursprünglichen Pressemeldung. Voraussetzung zur Aufnahme sei gewesen, dass nur jener Teil von Gauselmann Mitglied werde, „der sich fernab von Glücksspielen mit der Entwicklung von klassischen Games für Smartphones und Tablets beschäftigt“. Eine tiefergehende Prüfung habe nun aber gezeigt, dass das Unternehmen über keinen wesentlichen Anteil der Spieleentwicklung außerhalb von Glücksspielen verfügt bzw. sich solche Themen nicht eindeutig von den sonstigen Glücksspiel-Unternehmungen trennen ließen. Der neue BIU-Geschäftsführer Felix Falk, der sein Amt am 01. Januar 2017 angetreten hat und zuvor als Geschäftsführer der USK tätig war, konstatiert, auch er sei von dieser schon 2016 getroffenen Entscheidung erstaunt gewesen und erklärt: „Der BIU hat nie und wird unter meiner Leitung auch nie die Interessen von Glücksspiel-Anbietern vertreten.“
Ist die Posse Gauselmann damit vom Tisch? Vorerst wahrscheinlich. Die Frage indes bleibt, warum der größte – und nach dem eigenen Selbstverständnis alleinige – Vertreter der deutschen Branche eine tiefergehende Prüfung nicht schon vor dem Eintritt Gauselmanns veranlasste – oder wenigstens vor Bekanntgabe des Eintritts. Zumal Gauselmann in den vergangenen Jahren immer wieder im Mittelpunkt von Vorwürfen und juristischen Ermittlungen stand; von dubiosen Parteispenden ist die Rede und von manipulierten Automaten. Man möchte annehmen, dass der BIU einen Eintritt vor diesem Hintergrund besonders sorgfältig prüft. Das Gegenteil war offenbar der Fall.
Was ebenfalls bleibt, ist die Erkenntnis, dass eine formale Annäherung zwischen deutscher Games- und Glücksspiel-Industrie zwar vorläufig vom Tisch ist, aber signifikante Teile der Games-Industrie anscheinend keine Probleme mit einer solchen Annäherung hätten. Ob und inwiefern das ethisch problematisch ist, dazu kann man geteilter Meinung sein. Man kann es diskutieren. Man sollte sogar. Aber dazu muss man es erst einmal wissen.
***
Während die Causa Gauselmann gewissermaßen im journalistischen Hinterzimmer stattfand, stand eine andere Meldung tagelang im medialen Rampenlicht. Auch sie wirft ein Schlaglicht auf diese Branche, und auch in ihrem Fall lohnt eine nähere Betrachtung.
Was war passiert? Die Entwickler der Gefängnis-Simulation Prison Architect hatten Post vom britischen Roten Kreuz bekommen, weil ihr Spiel an einigen Stellen das Rote Kreuz verwendet. Der Anwalt des Roten Kreuzes verwies in dem Schreiben unter anderem darauf, dass das Symbol durch die Genfer Konvention und den britischen Geneva Conventions Act von 1957 geschützt sei, und bat darum, es zu entfernen.

Winziges Kreuz, große Wellen (Bild: PC Gamer)
Die daraus resultierenden Meldungen erscheinen bemerkenswert. Und zwar nicht deshalb, weil viele Medien reißerisch-irreführend behaupteten, man könne die Entwickler von Prison Architect nun als Kriegsverbrecher bezeichnen – mithin sogar „offiziell“. Das kann man bedauerlich finden, aber es ist wahrscheinlich die notwendige Konsequenz einer medialen Entwicklung, in der die Meldung von heute der chinesische Sack Reis von morgen ist.
Bemerkenswert finde ich jedoch, dass abseits der eingangs verlinkten PC Gamer-Geschichte niemand den ernsthaften Versuch unternommen zu haben scheint, die Position des Roten Kreuzes zu verstehen oder den eigenen Lesern verständlich zu machen. Liest man diese Meldungen, dann muss man beinahe zwangsläufig zu dem Schluss gelangen, dass das Rote Kreuz einen armen kleinen Spiele-Entwickler schlägermäßig mit dem Kopf in die Schultoilette steckt, kapitalistisch auf seinen Markenrechten besteht und Spendengelder für Abmahnanwälte missbraucht. Ein Eindruck, der von den Prison Architect-Entwicklern in einem Video übrigens nachdrücklich untermauert wird. Warum sollte man einer solchen Organisation noch etwas spenden? Schämen sollen die sich! Und überhaupt: Wieso bellt das Rote Kreuz ausgerechnet diesen kleinen sympathischen Baum an, wo andere Spiele großer Hersteller das Symbol doch auch schon benutzt haben?
Nun. Möglicherweise deshalb, weil Großbritannien nach dem bereits erwähnten Geneva Conventions Act von 1957 mithin die weltweit schärfsten nationalen Regelungen zur Darstellung des Roten Kreuzes eingeführt hat – und die Entwickler von Prison Architect ihren Sitz in England haben. Und möglicherweise geht es dem Roten Kreuz gar nicht um Markenrechte. Oder darum, einem kleinen Spiele-Entwickler vor den Bug zu schießen, bloß weil man kann.
Möglicherweise geht es ihm um das Leben seiner Mitarbeiter.
Das Symbol ist geschützt, weil die humanitäre Arbeit des Roten Kreuzes in Kriegs- und Krisengebieten ohne diesen Schutz unmöglich wäre. Entsprechend gekennzeichnete Personen, Fahrzeuge, Gebäude oder Zelte müssen für alle Konfliktparteien unmissverständlich und in Sekundenbruchteilen als tabu zu erkennen sein – sonst sterben Helfer, Verwundete, Zivilisten. Nun kann man freilich diskutieren, ob die harmlose Darstellung des Symbols in einem Spiel oder Film dazu geneigt wäre, diese Signal- und Tabuwirkung zu untergraben. Vielleicht ist sie das nicht. Aber was, wenn doch? Was, wenn ein völlig verängstigter MG- oder Panzerschütze beim Anblick des Roten Kreuzes eben nicht zuerst an Frauen, Kinder, Verwundete und humanitäre Helfer denkt – sondern an die gegnerischen Soldaten aus Battlefield, das Health Pack aus Doom, den Krankenwagen aus Prison Architect? Was, wenn er in einer posttraumatischen Stresssituation die tatsächliche Bedeutung des Symbols eine halbe Sekunde nach dem Betätigen des Auslösers realisiert?
Ist das abwegig? Möglicherweise. Aber dass das rote Kreuz dieses Risiko nicht eingehen will, erscheint mir verständlich.
Diskutieren allerdings kann man das. Wahrscheinlich muss man es sogar. Die Genfer Konvention und die daraus entstandenen Gesetze auf Landesebene stammen schließlich aus einer Zeit, in der moderne Massenmedien größtenteils noch Science Fiction waren. Sie können die Realität des 21. Jahrhunderts schlechterdings nicht abbilden. Deshalb ist diese Debatte auch nicht neu. Autor und Internet-Aktivist Cory Doctorow (Little Brother) beispielsweise kritisierte den Umgang des Roten Kreuzes mit medialen Darstellungen seines Symbols schon vor mehr als zehn Jahren. Vielleicht ist es höchste Zeit, dass wir vor diesem Hintergrund über den Einfluss von Spielen sprechen. Vielleicht komme ich am Ende zu der Überzeugung, dass meine heutige Position die falsche ist.
Aber dazu müssen wir die Position der (vermeintlichen) Gegenseite verstehen.
***
Gedanken aus dem Elfenbeinturm
Ich habe einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn wir eine altbekannte Frage einmal unter einem völlig anderen Blickwinkel betrachten. Sie lautet: Warum handeln Spieler scheinbar ständig gegen ihre eigenen Interessen?
Warum zum Beispiel bestellen sie millionenfach Spiele vor – und beklagen sich anschließend über Abstürze, Bugs, überlastete Server, fehlende Qualität? Warum kaufen sie DLCs und Saisonpässe – und lamentieren im Nachgang den Umstand, dass große Releases inzwischen nur noch filetiert auf den Markt kommen? Warum konsumieren sie Medien, die sie für tendenziös und käuflich halten? Warum investieren sie Millionenbeträge in virtuelle Rubbellose, um spielerisch nutzlose Kosmetik zu sammeln? Warum lassen sie sich von Herstellern und Entwicklern immer wieder ins Gesicht lügen – und finden das im Zweifel auch noch begrüßenswert, wie der folgende exemplarische Forenbeitrag illustriert:
„Ich denke eine wahre Aussage über aktuelle Softwareprobleme würde drastischer formuliert werden müssen – und sich schlimmer anhören als es ist. Das würden normale Leute falsch auffassen und das Vertrauen verlieren was zu einem Geldabriss führen könnte. Das mutet man den Leuten nicht zu so was zu verstehen.“
All das möchte man die Spieler fragen. Aber ich fürchte, ich kenne einen Teil der Antwort bereits: Weil Spiele – mehr noch als andere Medien – Träume verkaufen. Die beiden französischen Poststrukturalisten Gilles Deleuze und Félix Guattari haben in den 70ern das Konzept der Wunschmaschinen entworfen: Demnach existiert das Begehren nicht als imaginärer Einfluss, der auf einem Mangel basiert, sondern stellt eine tatsächliche, produktive Kraft dar – ähnlich einer Fabrik. Das Modell von Deleuze und Guattari bildet einen Gegenentwurf zur einflussreichen psychoanalytischen Theorie von Jacques Lacan, der dem Subjekt einen grundsätzlichen Mangel attestiert, der alles menschliche Begehren aufrechterhalte. Vereinfacht gesagt: Während Lacan und die psychoanalytische Theorie davon ausgehen, dass der Mensch von einem negativen Mangel gekennzeichnet ist, gehen Deleuze und Guattari von einem positiven Wunsch aus.
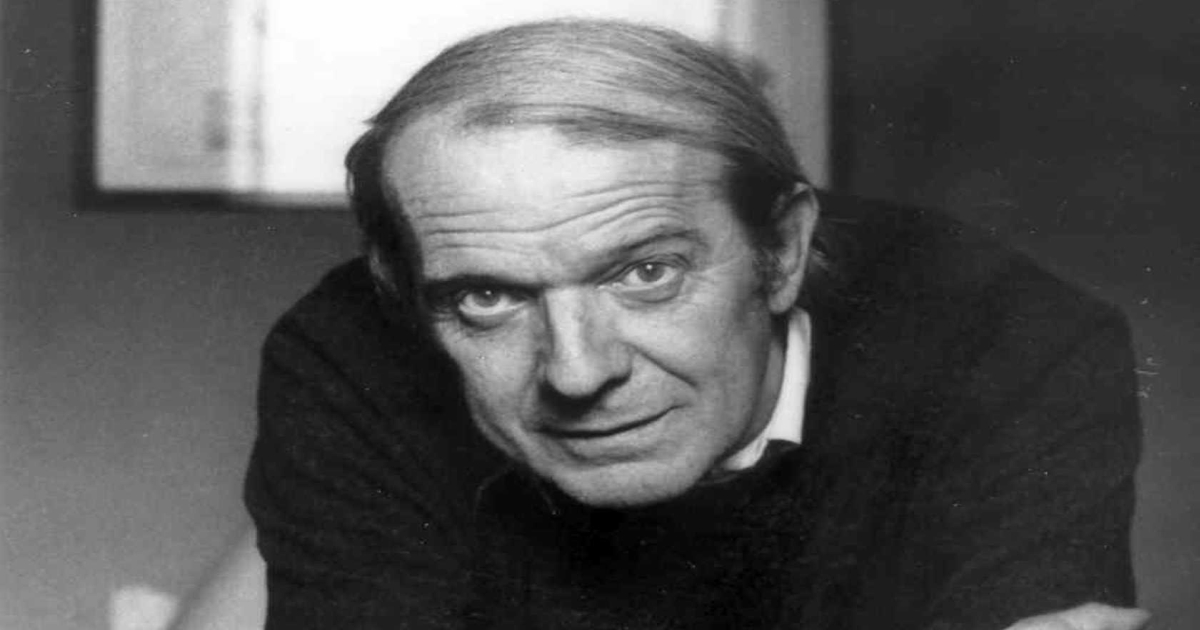
Gilles Deleuze (Bild: Núvol)
Betrachtet man zum Beispiel Star Citizen unter dieser Prämisse, dann könnte man argumentieren, dass es nicht etwa deshalb so erfolgreich ist, weil jahrelang keine Weltraumspiele existierten und es demnach einen Mangel bedient – sondern weil es jeden erdenklichen Wunsch an Weltraumspiele erfüllt. Es ist eine Wunschmaschine, ein in sich geschlossenes System, das sich selbst ernährt … und bei dem schon längst nicht mehr relevant ist (sofern das überhaupt je relevant war), wann es erscheint. Oder wie gut es bei diesem Erscheinen ist.
Folgt man dem maschinellen Ansatz von Deleuze und Guattari, dann speisen die Wunschmaschinen wiederum übergeordnete Gesellschaftsmaschinen. Auch das lässt sich auf Star Citizen übertragen, denn die Gemeinschaft ist keineswegs eine homogene, sondern setzt sich aus tausenden und abertausenden von individuellen Wunschmaschinen zusammen. Kein Wunsch ist identisch; nur die Aussicht auf kollektive Erfüllung eint. Ob – und in welchem Ausmaß – es sich dabei um realistische Wünsche handelt, spielt übrigens gar keine Rolle. Im Gegenteil: Wunschmaschinen produzieren Wünsche, keine Toaster.
Eine ähnliche Entwicklung kann man inzwischen bei nahezu jedem Triple-A-Release ausmachen. Über Mass Effect: Andromeda zum Beispiel sind zwei Monate vor Release so wenige handfeste Informationen bekannt, dass selbst Journalisten, die das Spiel live gesehen haben, keine verlässliche Aussage darüber treffen können, was es eigentlich ist. Ist es Dragon Age: Inquisition im Mass Effect-Universum? Oder doch eine Rückbesinnung auf alte Bioware-Tugenden? Das sind keine spitzfindigen Detailfragen, es geht mithin um das Wesen des Spiels. Man möchte instinktiv meinen, dass dieses Informationsdefizit spaltend und destruktiv wirkt, aber das Gegenteil ist der Fall. Solange der Spieler nicht weiß, was es nicht ist, arbeitet die Wunschmaschine. Ein Blick in die Community von Mass Effect offenbart deshalb ähnliche Strukturen wie bei Star Citizen: Kein Traum vom Spiel gleicht dem anderen, der einigende Faktor besteht in der Aussicht, dass jeder dieser Träume wahr wird. Solange das Spiel nicht erschienen ist, kann es Dragon Age: Inquistion im Weltraum und Rückkehr zu alten Bioware-Tugenden zugleich sein – auch wenn sich diese beiden Enden des Spektrums voraussichtlich gegenseitig ausschließen.
Natürlich wird am Ende ein Teil der Spieler enttäuscht oder verärgert zurückbleiben. Kein Spiel kann alle erdenklichen Wünsche erfüllen; erst recht nicht, wenn sie sich gegenseitig ausschließen. Aber begreift man das Wünschen eben nicht als imaginäre Reaktion auf einen subjektiv wahrgenommenen Mangel, sondern als maschinell-produktive Antriebskraft, als Wunschmaschine, dann wird verständlich, warum auch diese enttäuschten Spieler weiterhin vorbestellen und DLCs kaufen und Medien konsumieren, die sie im Zweifel für tendenziös und bestechlich halten: Weil sie wünschen.
Spiele verkaufen Träume. Romane, Filme oder Comics tun das auch. Aber im Gegensatz zu Spielen operieren sie notgedrungen in den Grenzen der Passivität. Ein Spiel hingegen macht mich zum Kampfpiloten, zum Drachentöter, zum Herrscher über die Galaxis. In einem Spiel entscheide ich über Leben und Tod. Ich rette Welten, und ich zerstöre Zivilisationen. Im Sinne von Deleuze und Guattari sind Spiele nicht bloß eine technische Entwicklung, nicht bloß das Abfallprodukt des Informationszeitalters, als das sie immer noch von vielen Geisteswissenschaftlern betrachtet werden. Sie sind das postmoderne Vehikel der Wunschmaschinen. Der Vorbesteller und DLC-Käufer, der Lootbox-Junkie und der Preview-Leser, der Star Citizen-Apologet und der Star Citizen-Hasser, sie alle sind Wunschmaschinen. Unsere Eingangsfrage – warum handeln Spieler scheinbar ständig gegen ihre eigenen Interessen – geht unter diesem Blickwinkel also von einer falschen Prämisse aus. Denn das tun sie gar nicht. Im Gegenteil.
***
Auf dem Nachttisch
Oder: Sie haben ohnehin schon viel zu lange nichts mehr gelesen
Die Mission: Ein unerhört lesenswerter Roman pro Kolumne
Die Kriterien: möglichst unbekannt und möglichst großartig
Heute: Christopher Brookmyre – The Sacred Art of Stealing (dt. Die hohe Kunst des Bankraubs; KiWi Verlag)
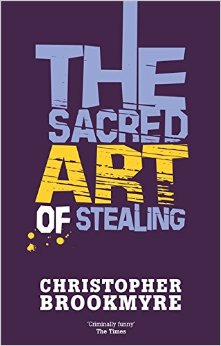
Mein bisheriges literarisches Leben lässt sich grob in zwei Zeitalter einteilen: vor dem Kindle und nach dem Kindle. Die prekindle’sche Ära roch nach Papier und schmeckte nach Druckerschwärze, und sie wird mir alleine deshalb immer die wertvollste sein, aber sie war auch eine Zeit der Angst. Angst vor langen Zugfahrten. Angst vor langen Flügen. Angst davor, nicht genug zu lesen dabei zu haben. Das war mir genau einmal passiert, und ich erinnere mich noch heute mit Schrecken daran. Im Anschluss konnte ich die Speisekarte des ICE-Boardbistro monatelang in mehreren Sprachen auswendig rezitieren und weiß bis heute, wie ich mich im Not- oder Brandfall zu verhalten habe. Als ich nach mehreren quälenden Stunden auf ein Faltblatt mit dem verheißungsvollen Titel „Ihre Anschlussverbindungen“ stieß, wusste ich endlich, wie sich Christopher Columbus bei der Entdeckung Amerikas gefühlt haben musste.
Ohne diese traumatische Erfahrung jedoch wäre ich wahrscheinlich nie auf den schottischen Autor Christopher Brookmyre gestoßen. Denn im festen Entschluss, diese infernalische Zugfahrt nicht noch einmal durchleiden zu müssen, erwarb ich fortan vor jeder Abfahrt mindestens einen Roman. So begab es sich also, dass ich im Nürnberger Bahnhofsbuchhandel stand und mit wachsender Panik durch die englischsprachigen Neuerscheinungen pflügte. Nur noch zehn Minuten, und alles war Tand oder skandinavische Krimis. Ich hatte mich insgeheim schon darauf eingestellt, den französischen Ausdruck für Königsberger Klopse näher kennenzulernen, als mir The Sacred Art of Stealing in die Hände fiel. Das klangt zumindest interessant. Ich schlug es auf, weil Klappentexte, wie jeder weiß, von wahnsinnigen Schwerverbrechern im Opiumrausch ersonnen werden, und las den folgenden ersten Satz:
„Was there anything quite so underrated in this shallow, plastic, global-corporate, tall-skinny-latte, kiddy-meal-and-free-toy, united-colors-of-fuck-you-too world, than a good old-fashioned, no-frills, retail blow job?“
Ich weiß nicht mehr, ob ich „Halleluja“ gerufen habe, aber ich weiß noch, dass die anschließende Zugfahrt eine der vergnüglichsten meines Lebens war. Auf rund 400 Seiten spinnt Brookmyre eine herrlich absurde und trotzdem jederzeit glaubhafte Räuberpistole rund um einen dadaistischen Banküberfall (wie man dadaistisch eine Bank überfällt? Zum Beispiel, indem man Warten auf Godot für die Geiseln aufführt), ein mexikanisches Drogenkartell und einen geradezu unverschämt cleveren Nichts-ist-so-wie-es-scheint-Raub als krönendes Finale. Die Dialoge sind fantastisch, die Figuren atmen einem förmlich ins Gesicht, und sprachlich gehört Christopher Brookmyre zum schlauesten und handwerklich bemerkenswertesten, was ich in der zeitgenössischen britischen Literatur gelesen habe – man darf bloß nicht zu jenem bedauernswerten Menschenschlag gehören, der dem tragischen Irrtum aufsitzt, dass bildhafte, fluchgewaltige Sprache ein untrügliches Indiz für Schund sei.
Christopher Brookmyre schreibt übrigens nicht nur großartige erste Sätze und Räuberpistolen, sondern hat mit der Jack Parlabane-Reihe auch einige der verdammt nochmal besten Polit-Thriller-Satiren des 21. Jahrhunderts verfasst (Quite Ugly One Morning; Country of the Blind; Boiling a Frog; Attack of the Unsinkable Rubber Ducks). Oh, und weil ich immer noch nicht über meine Schwäche für die Titel seiner Werke geschwärmt habe, lassen Sie mich die heutige Empfehlung doch bitte mit meinem Lieblingsroman von Brookmyre beenden. Darin geht’s unter anderem um Ego-Shooter, abgehalfterte Videospielgeschäfte und internationalen Terrorismus. Es heißt: A Big Boy Did It and Ran Away.
(Wer des Englischen mächtig ist und noch aus einer Generation stammt, in der große Pausen dem heiligen Fußballspiel auf dem Schulhof vorbehalten waren, dem sei an dieser Stelle der folgende frei verfügbare Text von Christopher Brookmyre sehr warm ans Herz gelegt).

